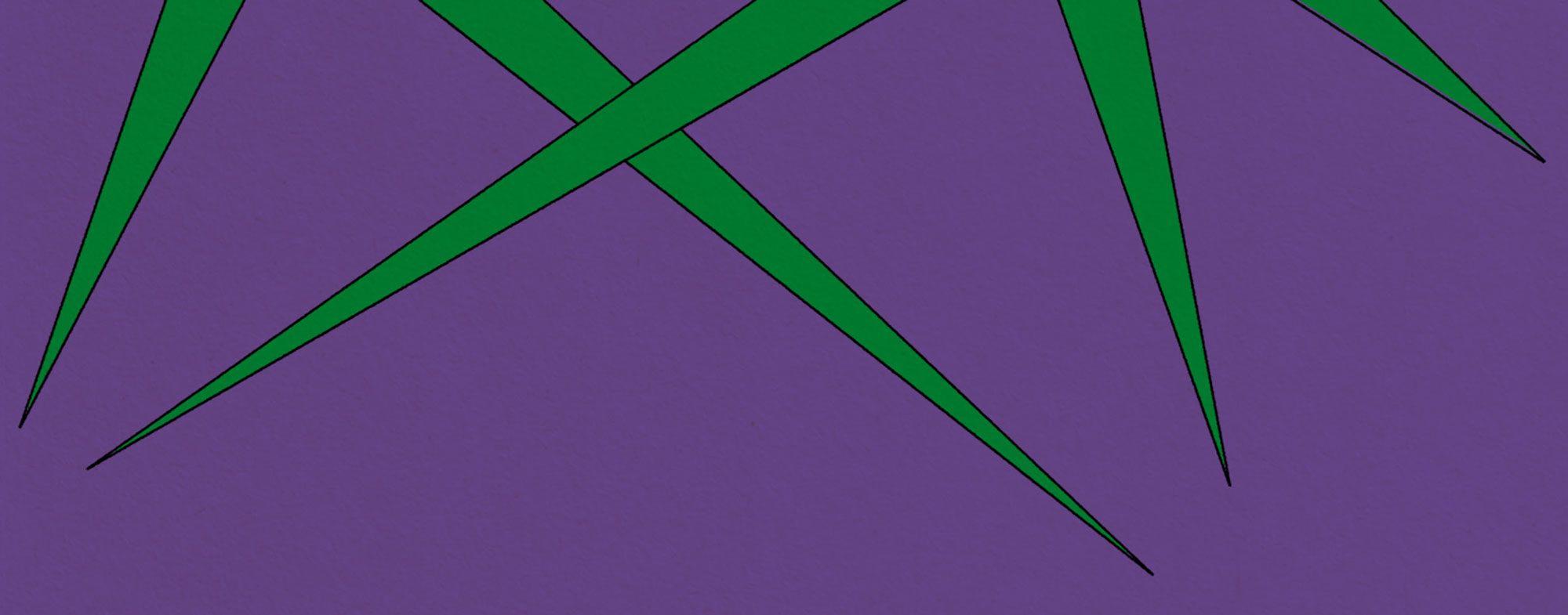Planung ist ein sozialer Prozess. Aber was bedeutet das? Nimmt man die Versuche gesellschaftlicher Planung im Realsozialismus zum Ausgangspunkt, bedeutet das vor allem, mit den Interessen der Planenden und der von Planung Betroffenen umzugehen. Diese sind der Natur der Sache nach sehr verschieden. Planungsverfahren müssen darum geeignet sein, diese Interessen aufzunehmen, zwischen gemeinsamen und besonderen Interessen abzuwägen und Wege zu ihrer Realisierung zu organisieren – oder die Realisierung bestimmter Interessen zu blockieren. Im Folgenden soll es darum gehen, die vorhandenen gesellschaftlichen Interessenlagen zu verstehen – eine Aufgabe, die theoretisch einfach erscheinen mag, aber in Wirklichkeit äußerst kompliziert ist. Grundlage ist die Erfahrung der Volkswirtschaftsplanung der DDR, doch letztlich ähnelten sich in allen realsozialistischen Staaten trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen und Voraussetzungen die Versuche, Probleme der planmäßigen Gestaltung der Gesellschaft zu lösen – zuerst in der Sowjetunion ab Anfang der 1920er-Jahre, dann in den übrigen Ländern nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Plan und Planmäßigkeit
Die an die Macht gekommenen kommunistischen Parteien folgten einem marxschen Verständnis einer nachkapitalistischen Gesellschaft. Marx, seine Mitstreiter*innen und Schüler*innen verstanden diese Gesellschaft nicht einfach als geplante, sondern mit Bewusstsein und in diesem Sinne planmäßig gestaltete Gesellschaft. Es ging ihnen also um gemeinsames Planen von allen für alle, und das im globalen Maßstab. In ihren Studien zu ökonomischen Fragen um 1912 hebt Rosa Luxemburg, anknüpfend an Marx, hervor, dass »Plan und Bewusstsein« (also Plan und Planmäßigkeit) zu unterscheiden seien (Luxemburg 2017, 234). Dabei stützt sie sich auf die Rolle von Planung in vorkapitalistischen, naturalwirtschaftlich geprägten Gesellschaften. Darauf baut eine wesentliche Grundannahme der späteren marxistischen Planungsdiskussion auf. Es ist grundsätzlich möglich, Gesellschaft bewusst zu gestalten und ökonomische und soziale Prozesse, den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, ausgehend von einer grundlegenden Interessenübereinstimmung zwischen den Gesellschaftsmitgliedern planmäßig zu organisieren.
Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel und die subjektive Entwicklung der Menschen in diesem Prozess sowie die Masse des zu Verteilenden sollten dazu führen, dass der soziale Egoismus und die Konkurrenz unter den Individuen ihre Grundlage verlieren. Man war sich dessen bewusst, dass dies eine voraussetzungsreiche Angelegenheit sein würde. Menschen müssen fähig sein, gemeinsam solidarisch ihre Interessen abzuwägen und dann einen Plan ihres miteinander abgestimmten Handelns zu verabreden – und sich danach auch zu verhalten. Planung sollte ein Instrument sein, um Gesellschaft insgesamt zu gestalten, nicht nur einzelne Segmente, wie dies für die Planung im Kapitalismus üblich war. Diese Fähigkeit – und damit die Möglichkeit der Planmäßigkeit in einer nachkapitalistischen Gesellschaft – erwachse, so die Vorstellung, aus dem sozialen Lernen unter den Bedingungen der kapitalistischen Großproduktion mit ihrer weitgefächerten, auch globalen Arbeitsteilung, zudem aus dem Erleben der daraus resultierenden sozialen Verheerungen. Die Planung der Produktion in den kapitalistischen Unternehmen, die Kriegswirtschaft und die Erfahrungen der Arbeitergenossenschaften sah man in weiten Teilen der Linken nach Ende des Ersten Weltkrieges als Zeichen dafür, dass die Zeit für eine Gesellschaft ohne Konkurrenz, Krisen, Arbeitslosigkeit, soziales Leid und koloniale Ausbeutung gekommen sei. Die Sozialisierungsdiskussionen dieser Zeit, verbunden mit Namen wie Richard Müller oder Otto Neurath, aber auch die von Lenin geprägte planwirtschaftliche Diskussion in Sowjetrussland hatten hier ihre Basis. Die Produktion sei nicht mehr abhängig von der Fähigkeit des einzelnen Unternehmers, sondern von der Fähigkeit der Gesellschaft, ihren »Stoffwechselprozess« mit der Natur und die damit verbundenen sozialen Beziehungen bewusst zu gestalten. Wenn das durch Erfahrung und Lernen verstanden sei, würde es auch keine Interessengegensätze mehr geben. Sie stellten also die Fähigkeit der Arbeiter*innen, bisher Objekt unternehmerischen und staatlichen Planens, ihre eigenen Interessen zu erkennen und entsprechend die Produktion und Distribution zu gestalten, und damit auch eine andere Qualität des Planens, in den Mittelpunkt.
Neue und alte Widersprüche
Allerdings ging man in Verkürzung der marxschen Überlegungen bei den ersten planwirtschaftlichen Versuchen gleichermaßen davon aus, dass Interessenwidersprüche auf dem Weg zum Sozialismus generell verschwinden und Solidarität Platz machen würden. Interessenübereinstimmung wurde als Interessenidentität verstanden. Ökonomische Erscheinungen wie Geld, Kredit usw. würden in der Folge ihre Bedeutung verlieren. Die Annahmen über das Verhalten der wirtschaftenden Subjekte, also der Betriebe, der Verwaltungen und der dort Arbeitenden, waren nach 1917 in Sowjetrussland und der UdSSR und dann nach 1945 in den realsozialistischen Ländern in vielerlei Hinsicht von einem revolutionären Optimismus, zum Teil von Illusionen, zumindest aber von den Hoffnungen eines völligen Neubeginns bestimmt.
Schon sehr früh wurde aber klar, dass die »Muttermale der alten Gesellschaft« beharrlicher sind, als die Revolutionär*innen 1917 oder 1945 meinten – und dass die neuen Widerspruchskonstellationen nicht weniger kompliziert waren. Erst einmal verändert eine politische Revolution die Bedingungen, unter denen Menschen leben und arbeiten, nur zum Teil. Der Produktionsapparat und die Technologien bleiben auch dann, wenn man das private Eigentum an den Produktionsmitteln abschafft oder einschränkt, erst einmal, wie sie waren. Das gilt auch für die Hierarchien unter den Beschäftigten, nicht zuletzt für die Widersprüche in den Geschlechterverhältnissen. Nikolai Bucharin stellte bereits 1920 die Frage, warum sich eigentlich die Arbeiter*innen nach der Revolution anders verhalten sollten als davor. Acht Stunden Arbeit am Band machen müde und begrenzen die Fähigkeit und die Lust, danach noch mit zu planen oder darüber nachzudenken, wie volkswirtschaftliche Zusammenhänge, die erst einmal mit dem eigenen Leben nichts zu tun zu haben scheinen, zu bewerten sind.
Dazu kam noch ein weiteres Problem. In »Moral und Klassennormen« stellte der Ökonom Evgenij Preobraženskij (1923) das Verhalten der Beschäftigten im Handel unter den Bedingungen des Kriegskommunismus, also einer (mehr oder weniger) geplanten bloßen Verteilung von Produkten ohne Dazwischentreten von Marktbeziehungen oder Geld, dem unter den Bedingungen der Neuen Ökonomischen Politik (NÖP) gegenüber. Im Zuge dieses wirtschaftspolitischen Kurswechsels wurden Markt, Handel und Geld wieder offiziell zugelassen. An der Tagesordnung, so Preobraženskij (1923, 66f), waren zuvor Unfreundlichkeit und Arroganz gewesen. Mit dem Kurswechsel seien die Verkäufer*innen in den Geschäften wieder freundlich und zuvorkommend geworden. Offensichtlich war, dass die Marktbeziehungen nicht einfach abgeschafft oder eingeführt werden können. Ihre Existenz war keine Frage von Ideologie oder Macht, sondern schien harte ökonomische Grundlagen zu haben. Vor diesem Hintergrund wurde klar, dass Planung in einer nachkapitalistischen Gesellschaft nicht einfach nur die Verteilung von Produkten und Leistungen betreffen konnte. Planung bedeutete Planung von Warenbewegungen, von Geldbewegungen usw. Die daraus resultierenden Widersprüche hatte Marx für den Kapitalismus analysiert. Was bedeuteten sie aber im Sozialismus, im Übergang zu einer nachkapitalistischen Gesellschaft? Um von der Planung zur planmäßigen Gestaltung der Gesellschaft zu kommen, musste Planung sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht als Prozess der Lösung von Interessenwidersprüchen begriffen werden bzw. als Prozess, dafür die Bedingungen zu schaffen. Darum drehten sich ab Mitte der 1950er-Jahre alle theoretischen Auseinandersetzungen und praktischen Reformversuche.
Es ging um das Verhältnis zwischen den Interessen der einzelnen Beschäftigten, den kollektiven Interessen des Betriebes und dem gesellschaftlichen Interesse, repräsentiert durch den Staat. Der Widerspruch zwischen dem berechtigten Interesse der Arbeiter*innen an hohem Lohn, soliden Sozialleistungen, angemessener Freizeit, normaler Arbeitsintensität, Möglichkeiten der Mitbestimmung auf der einen und das Interesse der Gesellschaft an hohen Arbeitsleistungen und -produktivität auf der anderen Seite war komplizierter zu lösen, als es schien. Um die Sozialpolitik abzusichern, brauchte es etwa ein beständiges Wachsen der Arbeitsproduktivität und eine regelmäßige Modernisierung des Produktionsapparates. Das wiederum war nur durch Qualifizierung, damit einhergehenden Veränderungen der Hierarchien unter den Beschäftigten und durch Infragestellen bisheriger sozialer Normen möglich. Alle diese Faktoren mussten zudem in entsprechende Kennziffern gefasst werden, um sie im Planungsprozess einer Bewertung und Gewichtung zugänglich zu machen. Dabei ging es darum, Naturalgrößen in Geld auszudrücken. Wie aber lässt sich Emanzipation (als Ziel des Sozialismus) in Finanzgrößen darstellen?
Zudem stellte sich die Frage, wie man die Widersprüche, die mit dem Verhältnis zwischen Stadt und Land, zwischen einzelnen Regionen oder die mit dem bürgerlichen Bildungsprivileg verbunden sind, lösen konnte. Die Proportionen zwischen Ausbildungsplätzen, Plätzen an Hochschulen und dem Bedarf an Arbeitskräften entsprechend der angestrebten wirtschaftlichen und sozialen Strukturen hatten zur Konsequenz, dass nicht alle die Ausbildung erhalten konnten, die sie eigentlich wollten. Die Förderung von Arbeiter*innenkindern an den Universitäten bedeutet für Kinder aus Intellektuellenhaushalten eine Benachteiligung, auch wenn es eine Vielzahl anderer Wege gab, schließlich doch noch zu studieren. Die besondere Förderung von Frauen stellte tradierte patriarchale Hierarchien in allen sozialen Schichten infrage. Um im Hochschulbereich zu bleiben: Auch die Verpflichtung, nach Abschluss des Studiums erst einmal eine Tätigkeit im angestrebten Beruf anzunehmen, die letztlich zugewiesen wurde (auch wenn es mehrere Vorschläge gab), stand oft im Widerspruch zu den eigenen Interessen und griff tief in persönliche Lebensplanungen ein. Selbst wenn man die gesellschaftliche Notwendigkeit einsah, bedeutet das noch lange nicht Zufriedenheit mit der Situation.
Wer wirtschaftet eigentlich?
Auf einer anderen Ebene stellte sich die grundsätzliche Frage nach dem Charakter der Objekte der Planung, der Produktionsstätten und Unternehmen, der Wirtschaftssubjekte. Von der Antwort auf diese Frage kommt man zu einer Charakterisierung der entsprechenden möglichen bzw. notwendigen Wege von Planung. Dabei spielte die Rolle der Ware-Geld-Beziehungen und des Markts eine zentrale Rolle. Ob eine nach- bzw. nichtkapitalistische Wirtschaft Warenproduktion ist oder nicht, ist bis heute heiß umstritten. Jenseits der politischen und ideologischen Dimension dieses Problems hängt von der Antwort ab, welchen Stellenwert man den Interessen der Wirtschaftssubjekte beimisst: Sind sie bloßes Objekt der Planung oder sind sie gleichzeitig Objekt und Subjekt?
Die Realität jedenfalls zeigte schnell, dass sie vollwertige Warenproduzenten sind und dass auch im Sozialismus als Übergangsgesellschaft der Markt existiert. Das galt nicht nur für die zum Beispiel in der DDR noch bestehenden Privatunternehmen, sondern auch für die volkseigenen bzw. genossenschaftlichen und staatlichen Betriebe. Außerdem waren die realsozialistischen Volkswirtschaften eng mit dem kapitalistisch dominierten Weltmarkt verflochten und konnten sich dort nicht anders als Warenproduzenten verhalten. Theorie und Wirtschaftspolitik rangen bis in die 1970er-Jahre darum, wie die in der Realität manifeste Gleichzeitigkeit von Plan und Markt zu fassen sei. Es setzte sich schließlich die Meinung durch, dass unter den gegebenen Bedingungen die für Wirtschaften ohne Warenbeziehungen typische Unmittelbarkeit der Beziehungen zwischen den wirtschaftenden Subjekten aufgrund der differenzierten Produktionsbedingungen noch nicht gegeben sei. Daher müssten sich die Arbeitsprodukte in Waren verwandeln, um ausgetauscht zu werden. Als Warenproduzenten und Marktteilnehmer mussten die Betriebe auf die sich wandelnde Nachfrage reagieren, ihre Waren mit Gewinn absetzen und möglichst hohe Preise realisieren, um Löhne zu zahlen und investieren zu können. Damit traten ihre Interessen in Widerspruch zu denen anderer Betriebe (die die gleichen Ziele hatten) und auch der Verbraucher*innen. Jede Vorgabe und jeder Abzug von Mitteln für gesellschaftliche Zwecke bedeuteten erst einmal, dass das Interesse der Betriebe an effektiverem Wirtschaften sank. Und das unabhängig davon, ob den Belegschaften diese Einschränkungen in Form von entsprechenden Sozialleistungen wieder zugutekamen.
Die Wirtschaftsreformen in allen Staaten des Realsozialismus ab den 1960ern bis zu deren Zerfall waren von Anstrengungen bestimmt, dieser Interessenkonstellation gerecht zu werden. Sie pendelten immer zwischen zwei Polen: der Erweiterung der Selbstständigkeit der Betriebe, was zwar zu größerer Innovationsfähigkeit, aber auch zu sozialen Verwerfungen wie wachsenden Einkommensunterschieden führte; und der Einschränkung ihrer Selbstständigkeit bei Entscheidungen über Investitionen und Sortiment, was wiederum zum Absinken der volkswirtschaftlichen Leistungskraft und zu Versorgungsproblemen führte. Keiner der Wege, sei es der eher zentralistische in der DDR, der jugoslawische Weg der Arbeiterselbstverwaltung oder der ungarische einer größeren Autonomie der Betriebe, konnte diese Probleme lösen.
Was lässt sich lernen?
Soweit man aus den Erfahrungen des Realsozialismus etwas lernen kann, ist es, dass der Ausgangspunkt für planwirtschaftliche Ansätze die realen Verhältnisse sein müssen. Darüber hinaus lassen sich kaum verlässliche Prognosen zu einer Planwirtschaft der Zukunft stellen. Alles hängt vom Milieu ab, in dem sich diese Frage wieder stellen wird. Auch jeder neue planwirtschaftliche Versuch wird einer im Übergang sein, in dem sich ökonomische, soziale und kulturelle Beziehungen neu herausbilden. Die Durchsetzung planmäßiger Entwicklung von Gesellschaft ist zudem das Ergebnis gesellschaftlicher Lernprozesse. Das bedeutet im Heute, die realen Planungsprozesse aufmerksam zu studieren und da mitzuwirken, wo es möglich ist, bzw. diese Möglichkeiten selbst zu schaffen. Der Versuch, die Haushaltspolitik zu demokratisieren, wie er im brasilianischen Porto Alegre und in Rio Grande do Sul Anfang der 2000er- Jahre unternommen wurde, war der vielleicht weitestgehende Versuch emanzipatorischer Planung. Die Ermittlung des Bedarfes an Leistungen, der Abgleich von Bedarfen und Ressourcen, die Priorisierung der Vorhaben in einem öffentlichen, basisdemokratischen Prozess, die davon ausgehende Formulierung klarer Aufträge an Parlamentarier*innen und Verwaltung und die öffentliche Rechenschaftslegung von Politik und Verwaltung über die Erfüllung der Aufträge der Bürger*innen bildeten einen Zyklus, der seinem Wesen nach dem Planungszyklus im Realsozialismus entsprach, ihn aber in ganz anderer Weise realisierte. Ausgehend von diesem basisdemokratisch erarbeiteten Konzept wurde dann der Einsatz von Computerprogrammen und Internet konzipiert. Für die gegenwärtigen Diskussionen lässt sich schlussfolgern, dass noch vor der Frage digitaler Planung und der Ersetzung von Geld durch andere Verrechnungseinheiten die nüchterne Analyse der wirkenden Interessen und der Reproduktionsbedingungen der Unternehmen stehen muss.
Die Ergebnisse solcher Versuche werden immer wieder überraschen. In diesem Falle fühlten sich Rechtskonservative und linke Avantgardist*innen gleichermaßen in ihrem vermeintlichen Monopol, die Interessen »der Menschen« zu repräsentieren, gefährdet. Die Initiative scheiterte am Widerstand beider Lager. Ähnlich erging es Initiativen in Deutschland, die von diesem Projekt inspiriert waren. Vor der Entwicklung von Planungsmodellen muss die Entwicklung der Fähigkeit zur Selbstveränderung stehen. Auch wenn es unterschätzt wird – der Übergang von Planung zu Planmäßigkeit ist letztendlich auch eine »Kulturrevolution«. Diese muss jetzt beginnen, nicht erst, wenn die Frage gesellschaftlicher Planung aktuell wird.