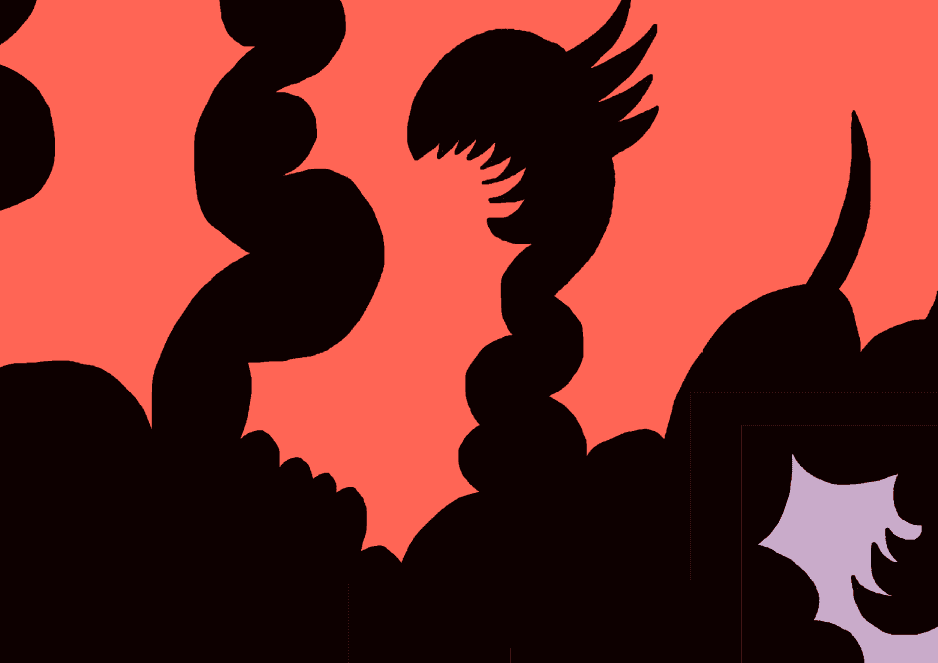Die Sozialwissenschaftler*innen Daniel Mullis, Maximilian Pichl und Vanessa E. Thompson warnten jüngst vor »autoritären Kipppunkten« in Deutschland. Wo sie überschritten werden, würde »der Boden brüchig, auf dem plurale und demokratische Gesellschaften stehen« (Mullis u. a. 2023). Die Diagnose ist so nachvollziehbar wie die mit ihr verbundene Warnung. Halb Europa blickt auf die aktuellen Umfragewerte der AfD: Ein von Rechtsextremen regiertes Deutschland würde die politischen Realitäten nicht nur im Land, sondern auf dem Kontinent bedrohlich verändern.
Noch 2018 konnte der Politikwissenschaftler Philipp Manow in seinem viel beachteten Buch zur »politischen Ökonomie des Populismus« die Beispiele von Spanien und Italien heranziehen, um seine These zu illustrieren, wonach der Süden Europas auf die Folgen der Globalisierung mit »linkem«, der Norden mit »rechtem« Protest reagiere. Doch schon im Jahr darauf schaffte die ultrarechte Vox den Durchbruch mit über 15 Prozent bei den spanischen Parlamentswahlen. Die Erfolge erst der Lega von Matteo Salvini, dann der Fratelli d’Italia unter Giorgia Meloni in Italien haben seit 2019 gleich zwei verschiedene extrem rechte Parteien in der größten Volkswirtschaft Südeuropas in Regierungsämter gebracht.
Autoritär-populistische, extrem rechte Parteien sind heute in fast allen Ländern Europas Teil des etablierten Parteienspektrums und ein wesentlicher Faktor im Spiel der politischen Kräfte. In Deutschland ist die Normalisierung der AfD mit dem öffentlichen Schleifen der »Brandmauer« durch die Unionsparteien im Sommer 2023 vollzogen; der internationale Vergleich zeigt, dass sie wohl nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Selbst spektakuläre Skandale müssen rechtspopulistischen Parteien dann nicht nachhaltig schaden. Das zeigt das Beispiel Österreichs: Die FPÖ hat sich von ihrer tiefen Krise nach diversen Korruptionsvorwürfen nicht nur erholt, sondern liegt in allen Umfragen seit Monaten auf dem ersten Platz.
Von Deutschland aus betrachtet mangelt es weder an internationalen Erfahrungswerten, was den Umgang mit dem autoritären Populismus betrifft, noch an Dringlichkeit, diesen Umgang anders zu gestalten. Und doch gehört es zu den besonders frustrierenden Zeichen unserer Zeit, dass die politischen Akteur*innen gerade alle Fehler wiederholen, die in Ländern wie Frankreich, Italien oder Österreich seit Jahren gemacht werden – und in den drei Ländern ist die extreme Rechte derzeit an der Macht oder in Umfragen stärkste Partei. Große Medien und der öffentlich-rechtliche Rundfunk bieten der AfD kostenlosen Platz für ihre Propaganda – die einen, um Reichweite zu generieren; die nächsten, weil sie meinen, die Rechten sich selbst entzaubern lassen zu können; manche, weil sie selbst deren Ansichten teilen; wieder andere erhoffen sich Vorteile von der frühen Nähe zu einem künftigen Machtzentrum. Führende Konservative wollen der extremen Rechten den »Wind aus den Segeln nehmen«, wie es im Politikbetriebsjargon heißt, indem sie ihre Inhalte übernehmen. Und die Linke zerfetzt sich über der Frage, wie auf die rechten Erfolge zu reagieren sei: Gibt es von links etwas zu bergen im rechten Aufbruch? Sind, wie Chantal Mouffe meint, »viele der von rechtspopulistischen Parteien artikulierten Forderungen demokratische Forderungen [...], die einer progressiven Antwort bedürfen« (Mouffe 2018, 32)? Oder müssen im Gegenteil die Reihen gegen rechts im Namen der offenen Gesellschaft geschlossen, die entfesselten Kräfte als Ressentiment enttarnt und zurückgewiesen werden?
Ökonomie vs. Kultur?
Die sozialwissenschaftliche Forschung zu Populismus, die seit dem Trump- und Brexit-Jahr 2016 international boomt, hat in dieser Situation bedauerlich wenig anzubieten. Das beginnt schon damit, dass Unterstützung für autoritär-populistische Parteien weiterhin allzu oft als »Protest« (z. B. Manow 2018; Stegemann 2018) gedeutet und unterschätzt wird, dass sich der autoritäre Populismus längst als eigenständige Kraft im Kampf um Hegemonie etabliert hat. Die empirischen Befunde zur Ursache populistischer Erfolge sind widersprüchlich, die Interpretationsversuche doppeln weitgehend Konfliktlinien, die im politischen Feld selbst existieren. Sind es zuvorderst »ökonomische« Faktoren, die Menschen zur Wahl rechtspopulistischer Parteien treiben, oder »kulturelle«? Für beides finden sich Argumente in Büchern und Fachartikeln.
Die klügeren Analysen weisen darauf hin, dass die Trennung zwischen »ökonomischen« und »kulturellen« Faktoren selbst irreführend ist (Mullis/Zschocke 2020; Biskamp 2019; vgl. Opratko 2021). Erstens weil sich im Alltagsverstand (nicht nur) jener, die autoritäre Politik unterstützen, sogenannte kulturelle und sogenannte ökonomische Elemente unauflöslich miteinander vermengen. Etwa wenn das Aussehen der Menschen in der Nachbarschaft in ein kausales Verhältnis zu tatsächlichen oder befürchteten negativen Erfahrungen im Arbeitsleben gesetzt wird. Wie Daniel Mullis und Paul Zschocke auf Basis von Interviews in Stadtteilen mit hohem AfD-Zuspruch folgern: »Aus unseren bisherigen Erfahrungen schließen wir, dass politische Entscheidungen [...] nicht in kausaler Weise beschrieben werden können. Ökonomische Faktoren sind nicht von kulturellen und vice versa zu trennen, vielmehr sind sie in alltäglichen Erfahrungen inhärent verschränkt« (Mullis/Zschocke 2020, 142).